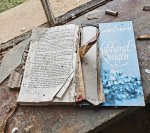Die letzten Tage führte ich meine Erkundung in der Steiermark fort, unter anderem entdeckte ich das ehem. Bergbaugebiet Wies-Eibiswalder Revier!
Das Wies- Eibiswalder Revier:
Eine Reise durch fast 200 Jahre Kohlebergbau……

Übersicht über die Glanzkohlereviere
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
Eibiswalder Revier:
Abbaue um den Markt Eibiswald, in Feisternitz und Hörmsdorf
Vordersdorfer und Wernersdorfer Revier:
Abbaue in Vordersdorf und Wernersdorf- Unterfresen
Wieser Revier:
Abgebaut wurde in Pölfing- Bergla, Steyeregg, Kalkgrub- Limberg,
St.Ulrich, Tombach- Pitschgauegg
Das sogenannte „Eiswalder Flöz“ wurde in drei verschiedene Gebiete bergmännisch bearbeitet: im Raum südlich von Eibiswald, im Feisternitzer Revier (mit dem Herma- und Lauraschacht) und nordöstlich von Eibiswald im Charlotte- Marie- Revier.
Im Eibiswalder Revier waren folgende Haupteinbaue (nach DI Claus Lukasczyk):

Herma- Schacht 1842- 1890 (Teufe 29 Meter)
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal

Laura- Schacht 1880- 1912 (Teufe 123 Meter)
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
Das Wieser Revier:
Unter dem Begriff „Wieser Revier“ werden all jene Bergbaue verstanden.
Das waren die Gruben in Kalkgrub- Limberg, Steyeregg, Pölfing- Bergla und Aug- Schöngg, St. Ulrich und Tombach- Pitschgauegg.
1926 wurde das „Wieser Flöz“ als „eine im großen ziemlich regelmäßige Flözplatte“ beschrieben.
1878 waren die Bergbaue im Bereich des „Wieser Flözes“ im Eigentum von neun Einzelunternehmen, drei Gesellschaften und drei Aktiengesellschaften.
In Betrieb standen damals 11 Schächte und 26 Hauptförderstollen, wobei die Abbaue in einer Teufe von durchschnittlich 127 Metern umgingen.
Der Raum Kalkgrub- Limberg:
Etwa zwei Kilometer nordwestlich von Steyeregg in Richtung Schwanberg liegt das Bergbaugebiet von Kalkgrub- Limberg. Das Flöz wird in diesem Bereich als 0,9 bis 3,2 Meter mächtig, jedoch durch sandig- tonige Zwischenmittel in mehrere Bänke gegliedert, beschrieben. Die Kohle von Kalkgrub- Limberg ist als schwarze Glanzkohle zu bezeichnen.

Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
1919 wurde die Knappenmusik- und Gesangsverein Haraldschacht, die Vorgänger der Bergkapelle Pölfing- Bergla und unserer Berg- und Hüttenkapelle St. Martin, gegründet.
Weitere aufschlussreiche Infos unter: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
Das Wies- Eibiswalder Revier:
Eine Reise durch fast 200 Jahre Kohlebergbau……

Übersicht über die Glanzkohlereviere
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
Eibiswalder Revier:
Abbaue um den Markt Eibiswald, in Feisternitz und Hörmsdorf
Vordersdorfer und Wernersdorfer Revier:
Abbaue in Vordersdorf und Wernersdorf- Unterfresen
Wieser Revier:
Abgebaut wurde in Pölfing- Bergla, Steyeregg, Kalkgrub- Limberg,
St.Ulrich, Tombach- Pitschgauegg
Das sogenannte „Eiswalder Flöz“ wurde in drei verschiedene Gebiete bergmännisch bearbeitet: im Raum südlich von Eibiswald, im Feisternitzer Revier (mit dem Herma- und Lauraschacht) und nordöstlich von Eibiswald im Charlotte- Marie- Revier.
Im Eibiswalder Revier waren folgende Haupteinbaue (nach DI Claus Lukasczyk):

Herma- Schacht 1842- 1890 (Teufe 29 Meter)
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal

Laura- Schacht 1880- 1912 (Teufe 123 Meter)
Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
Das Wieser Revier:
Unter dem Begriff „Wieser Revier“ werden all jene Bergbaue verstanden.
Das waren die Gruben in Kalkgrub- Limberg, Steyeregg, Pölfing- Bergla und Aug- Schöngg, St. Ulrich und Tombach- Pitschgauegg.
1926 wurde das „Wieser Flöz“ als „eine im großen ziemlich regelmäßige Flözplatte“ beschrieben.
1878 waren die Bergbaue im Bereich des „Wieser Flözes“ im Eigentum von neun Einzelunternehmen, drei Gesellschaften und drei Aktiengesellschaften.
In Betrieb standen damals 11 Schächte und 26 Hauptförderstollen, wobei die Abbaue in einer Teufe von durchschnittlich 127 Metern umgingen.
Der Raum Kalkgrub- Limberg:
Etwa zwei Kilometer nordwestlich von Steyeregg in Richtung Schwanberg liegt das Bergbaugebiet von Kalkgrub- Limberg. Das Flöz wird in diesem Bereich als 0,9 bis 3,2 Meter mächtig, jedoch durch sandig- tonige Zwischenmittel in mehrere Bänke gegliedert, beschrieben. Die Kohle von Kalkgrub- Limberg ist als schwarze Glanzkohle zu bezeichnen.

Bildquelle: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal
1919 wurde die Knappenmusik- und Gesangsverein Haraldschacht, die Vorgänger der Bergkapelle Pölfing- Bergla und unserer Berg- und Hüttenkapelle St. Martin, gegründet.
Weitere aufschlussreiche Infos unter: Berg & Hüttenkapelle St. Martin im Sulmtal