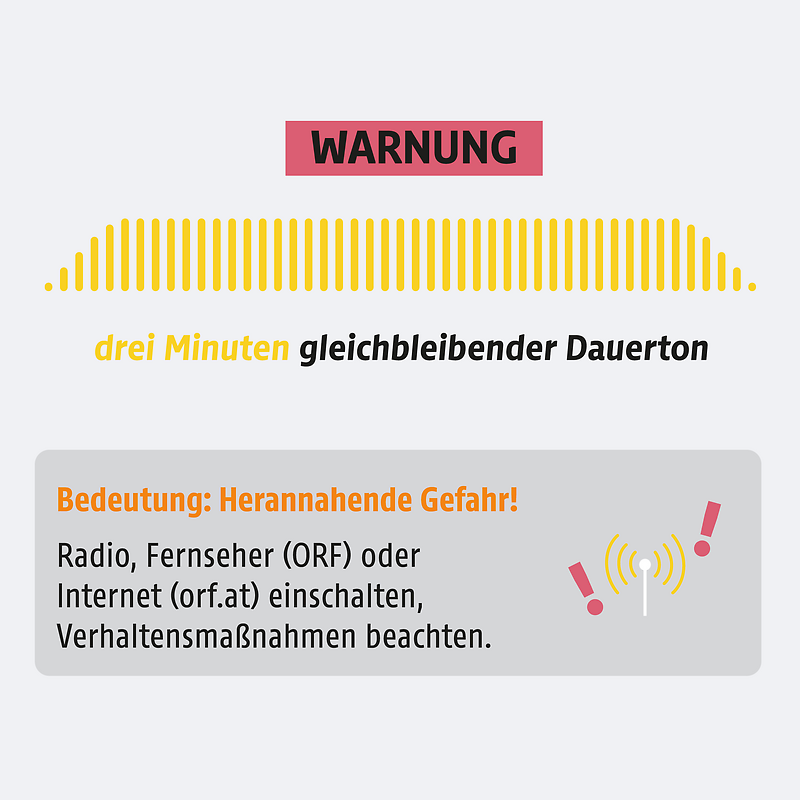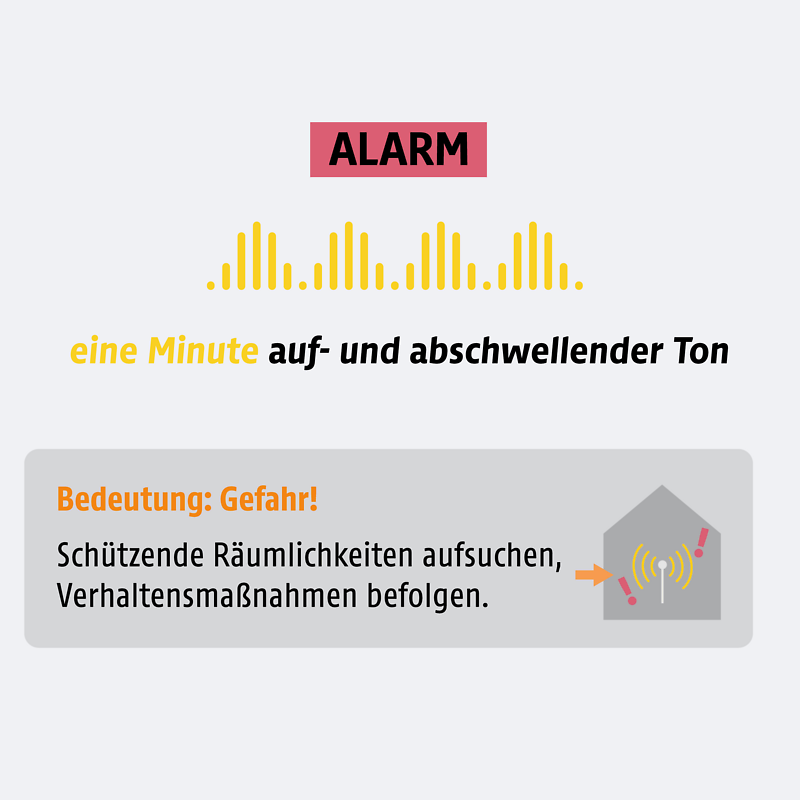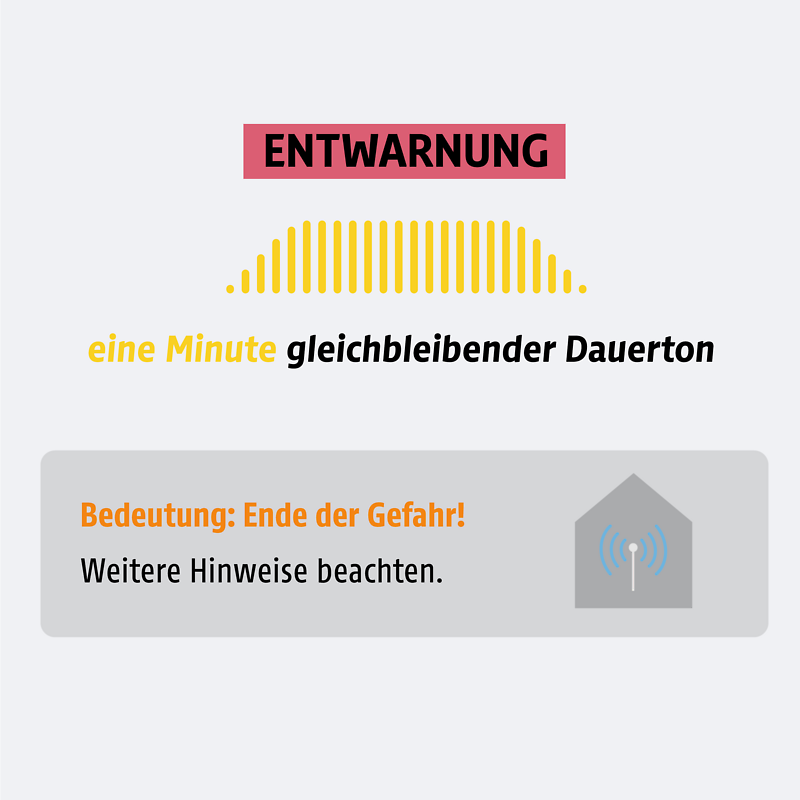So entsorgt man Batterien
 iStock/oonal
iStock/oonal
Batterien und Akkus begleiten uns den ganzen Tag. Sie stecken in Elektrozahnbürsten und Rasierapparaten, in Fernbedienungen, Radios und im Spielzeug unserer Kinder. Sie sorgen dafür, dass wir unserer Arbeit mit Laptops, Notebooks und Tablets nachgehen können. Und sie halten Handys, Smartwatches und Co am Laufen. Kurzum: Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Trotzdem wissen wir über die so wichtigen Helferchen erstaunlich wenig. Hätten Sie zum Beispiel geahnt, dass es bereits in der Antike eine Art Batterie gab? Oder dass der kleinste Akku der Welt dünner ist als ein menschliches Haar? Oder auch, dass nur die Hälfte der Batterien und Akkus fachgerecht entsorgt werden? Ja, richtig gelesen! An sich sind wir beim Mülltrennen zwar sehr fleißig, doch bei Batterien und Akkus sieht es weniger gut aus.
Batterien und Akkus landen oft im Restmüll
Obwohl die Mehrheit der Österreicher darüber Bescheid weiß, dass Batterien und Akkus im Restmüll nichts verloren haben, landen sie gar nicht so selten dort. So gaben einer Studie zufolge 2018 nur 56 Prozent der Befragten an, die Energiespeicher immer fachgerecht zu entsorgen. Ein gutes Drittel der Befragten hat diese auch schon kurzerhand in den Restmüll geschmissen. 2021 dürfte das nicht mehr ganz so oft vorkommen. Denn eine (im Auftrag der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle EAK) heuer bereits zum dritten Mal in einer repräsentativen market-Umfrage durchgeführte Erhebung zeigt, dass das Bewusstsein für die korrekte Entsorgung von Altbatterien und Elektroaltgeräten gestiegen ist.
Batterien und Akkus entsorgen? Ja sagt Hermit Leer!
Batterien und Akkumulatoren enthalten eine Reihe wertvoller Rohstoffe, aber auch gefährliche Inhaltsstoffe. Was für den Betrieb verschiedenster Elektrogeräte unverzichtbar ist, kann großen Schaden anrichten, wenn es in die Umwelt gelangt. Wenn ihnen sprichwörtlich „der Saft ausgeht“, sollten Sie Ihre Energiespender daher niemals leichtfertig einfach irgendwo abladen. Doch auch wenn sie im Restmüll landen, sind selbst noch so kleine Batterien ein großes Problem.
Denn: Beim Pressen und Verarbeiten des Restmülls werden Batterien leicht beschädigt, können sehr heiß werden und dabei Brände verursachen, die Sachschäden in Millionenhöhe zur Folge haben. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Mineralien, die unter großem Aufwand gewonnen werden. Aus dem Restmüll können diese Metalle nicht recycelt werden. Sie gehen schlichtweg verloren.
Warum die richtige Entsorgung so wichtig ist, erklärt auch das Testimonial „Hermit Leer“ im Video:
Wo leere Energiespender & Co hingehören
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Batterien und Akkus richtig zu entsorgen:
1. Über spezielle Batterie-Sammelboxen im Handel
Alle Unternehmen, die Batterien und Akkus verkaufen, müssen diese in gebrauchtem Zustand auch wieder zurücknehmen – und zwar unabhängig von einem Neukauf. Am einfachsten funktioniert die Entsorgung ausgedienter Batterien und Akkus daher über den Handel. Immerhin liegen Supermärkte, Baumärkte, Elektrohändler oder Drogeriemärkte meist am täglichen Weg. So gestaltet sich die Entsorgung in den speziellen Batterie-Sammelboxen, die sich meist beim Kassen- beziehungsweise im Ausgangsbereich befinden, besonders einfach und ist zudem ruckzuck erledigt.
2. In einer von rund 2.000 Sammelstellen in ganz Österreich
Kostenlos entsorgen können Sie alte Gerätebatterien und Akkus aber nicht nur im Handel, sondern auch bei den rund 2.000 kommunalen Sammelstellen der Städte und Gemeinden im ganzen Land. Hier sollten Sie zudem alle kaputten Elektro-Kleingeräte wie beispielsweise Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen oder Radios, Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder Handkreissägen und sämtliches Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Telefone oder Headsets sowie auch alle anderen kaputten Elektrogeräte hinbringen.
Kurzschlüsse mit Brandgefahr bei falscher Lagerung zu Hause
Bis leere Batterien und Akkus zur Sammelbox oder Sammelstelle gebracht werden, liegen sie in vielen Haushalten mitunter wochenlang in Tüten oder Schachteln. Im ersten Moment klingt dies praktisch und unbedenklich. Bei näherem Hinsehen offenbaren sich jedoch gefährliche Tücken: So kann es nach einem Auslaufen der Batterien beispielsweise passieren, dass Plus- und Minuspol miteinander in Kontakt kommen. Das kann einen Kurzschluss verursachen. Daheim sollte man Batterien daher am besten in einem leeren Glas mit Schraubdeckel verwahren.
Problematisch sehen Experten zudem die Lagerung und Sammlung von Lithium-Akkus, die etwa in Handys, Laptops, Digicams, aber auch in mobilen Handwerkzeugen wie Akkubohrern und -schraubern sowie in E-Bikes im Einsatz sind. Denn diese Akkus können auf starke Wärmezufuhr, Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen reagieren. Gebrauchte Lithium-Akkus, aber auch Blockbatterien, sichern Sie vor der Entsorgung daher am besten durch Abkleben der Batteriepole gegen Kurzschluss, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.
Mehr rund um die richtige Entsorgung von Batterien, Akkus und Elektroaltgeräten erfahren Sie unter hermitleer.at.
Promotion - DER STANDARD

Batterien und Akkus begleiten uns den ganzen Tag. Sie stecken in Elektrozahnbürsten und Rasierapparaten, in Fernbedienungen, Radios und im Spielzeug unserer Kinder. Sie sorgen dafür, dass wir unserer Arbeit mit Laptops, Notebooks und Tablets nachgehen können. Und sie halten Handys, Smartwatches und Co am Laufen. Kurzum: Sie sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken.
Trotzdem wissen wir über die so wichtigen Helferchen erstaunlich wenig. Hätten Sie zum Beispiel geahnt, dass es bereits in der Antike eine Art Batterie gab? Oder dass der kleinste Akku der Welt dünner ist als ein menschliches Haar? Oder auch, dass nur die Hälfte der Batterien und Akkus fachgerecht entsorgt werden? Ja, richtig gelesen! An sich sind wir beim Mülltrennen zwar sehr fleißig, doch bei Batterien und Akkus sieht es weniger gut aus.
Batterien und Akkus landen oft im Restmüll
Obwohl die Mehrheit der Österreicher darüber Bescheid weiß, dass Batterien und Akkus im Restmüll nichts verloren haben, landen sie gar nicht so selten dort. So gaben einer Studie zufolge 2018 nur 56 Prozent der Befragten an, die Energiespeicher immer fachgerecht zu entsorgen. Ein gutes Drittel der Befragten hat diese auch schon kurzerhand in den Restmüll geschmissen. 2021 dürfte das nicht mehr ganz so oft vorkommen. Denn eine (im Auftrag der Elektroaltgeräte Koordinierungsstelle EAK) heuer bereits zum dritten Mal in einer repräsentativen market-Umfrage durchgeführte Erhebung zeigt, dass das Bewusstsein für die korrekte Entsorgung von Altbatterien und Elektroaltgeräten gestiegen ist.
Batterien und Akkus entsorgen? Ja sagt Hermit Leer!
Batterien und Akkumulatoren enthalten eine Reihe wertvoller Rohstoffe, aber auch gefährliche Inhaltsstoffe. Was für den Betrieb verschiedenster Elektrogeräte unverzichtbar ist, kann großen Schaden anrichten, wenn es in die Umwelt gelangt. Wenn ihnen sprichwörtlich „der Saft ausgeht“, sollten Sie Ihre Energiespender daher niemals leichtfertig einfach irgendwo abladen. Doch auch wenn sie im Restmüll landen, sind selbst noch so kleine Batterien ein großes Problem.
Denn: Beim Pressen und Verarbeiten des Restmülls werden Batterien leicht beschädigt, können sehr heiß werden und dabei Brände verursachen, die Sachschäden in Millionenhöhe zur Folge haben. Außerdem enthalten Batterien wertvolle Mineralien, die unter großem Aufwand gewonnen werden. Aus dem Restmüll können diese Metalle nicht recycelt werden. Sie gehen schlichtweg verloren.
Warum die richtige Entsorgung so wichtig ist, erklärt auch das Testimonial „Hermit Leer“ im Video:
Wo leere Energiespender & Co hingehören
Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, Batterien und Akkus richtig zu entsorgen:
1. Über spezielle Batterie-Sammelboxen im Handel
Alle Unternehmen, die Batterien und Akkus verkaufen, müssen diese in gebrauchtem Zustand auch wieder zurücknehmen – und zwar unabhängig von einem Neukauf. Am einfachsten funktioniert die Entsorgung ausgedienter Batterien und Akkus daher über den Handel. Immerhin liegen Supermärkte, Baumärkte, Elektrohändler oder Drogeriemärkte meist am täglichen Weg. So gestaltet sich die Entsorgung in den speziellen Batterie-Sammelboxen, die sich meist beim Kassen- beziehungsweise im Ausgangsbereich befinden, besonders einfach und ist zudem ruckzuck erledigt.
2. In einer von rund 2.000 Sammelstellen in ganz Österreich
Kostenlos entsorgen können Sie alte Gerätebatterien und Akkus aber nicht nur im Handel, sondern auch bei den rund 2.000 kommunalen Sammelstellen der Städte und Gemeinden im ganzen Land. Hier sollten Sie zudem alle kaputten Elektro-Kleingeräte wie beispielsweise Bügeleisen, Mixer, Kaffeemaschinen oder Radios, Werkzeuge wie Bohrmaschinen oder Handkreissägen und sämtliches Computerzubehör wie Tastatur, Drucker, Maus, USB-Sticks, Telefone oder Headsets sowie auch alle anderen kaputten Elektrogeräte hinbringen.
Kurzschlüsse mit Brandgefahr bei falscher Lagerung zu Hause
Bis leere Batterien und Akkus zur Sammelbox oder Sammelstelle gebracht werden, liegen sie in vielen Haushalten mitunter wochenlang in Tüten oder Schachteln. Im ersten Moment klingt dies praktisch und unbedenklich. Bei näherem Hinsehen offenbaren sich jedoch gefährliche Tücken: So kann es nach einem Auslaufen der Batterien beispielsweise passieren, dass Plus- und Minuspol miteinander in Kontakt kommen. Das kann einen Kurzschluss verursachen. Daheim sollte man Batterien daher am besten in einem leeren Glas mit Schraubdeckel verwahren.
Problematisch sehen Experten zudem die Lagerung und Sammlung von Lithium-Akkus, die etwa in Handys, Laptops, Digicams, aber auch in mobilen Handwerkzeugen wie Akkubohrern und -schraubern sowie in E-Bikes im Einsatz sind. Denn diese Akkus können auf starke Wärmezufuhr, Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen reagieren. Gebrauchte Lithium-Akkus, aber auch Blockbatterien, sichern Sie vor der Entsorgung daher am besten durch Abkleben der Batteriepole gegen Kurzschluss, da ansonsten das Risiko eines Brandes besteht.
Mehr rund um die richtige Entsorgung von Batterien, Akkus und Elektroaltgeräten erfahren Sie unter hermitleer.at.
Promotion - DER STANDARD